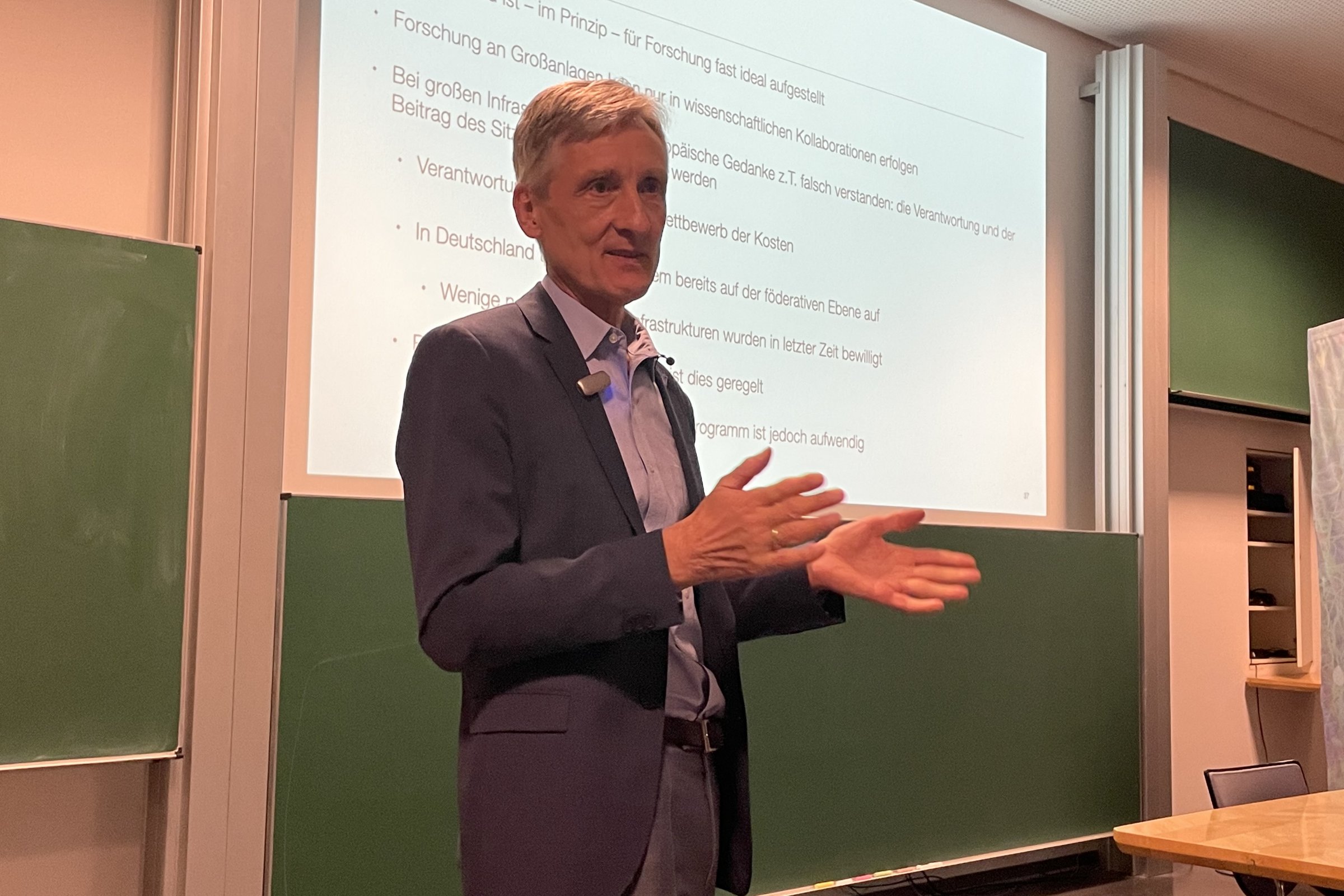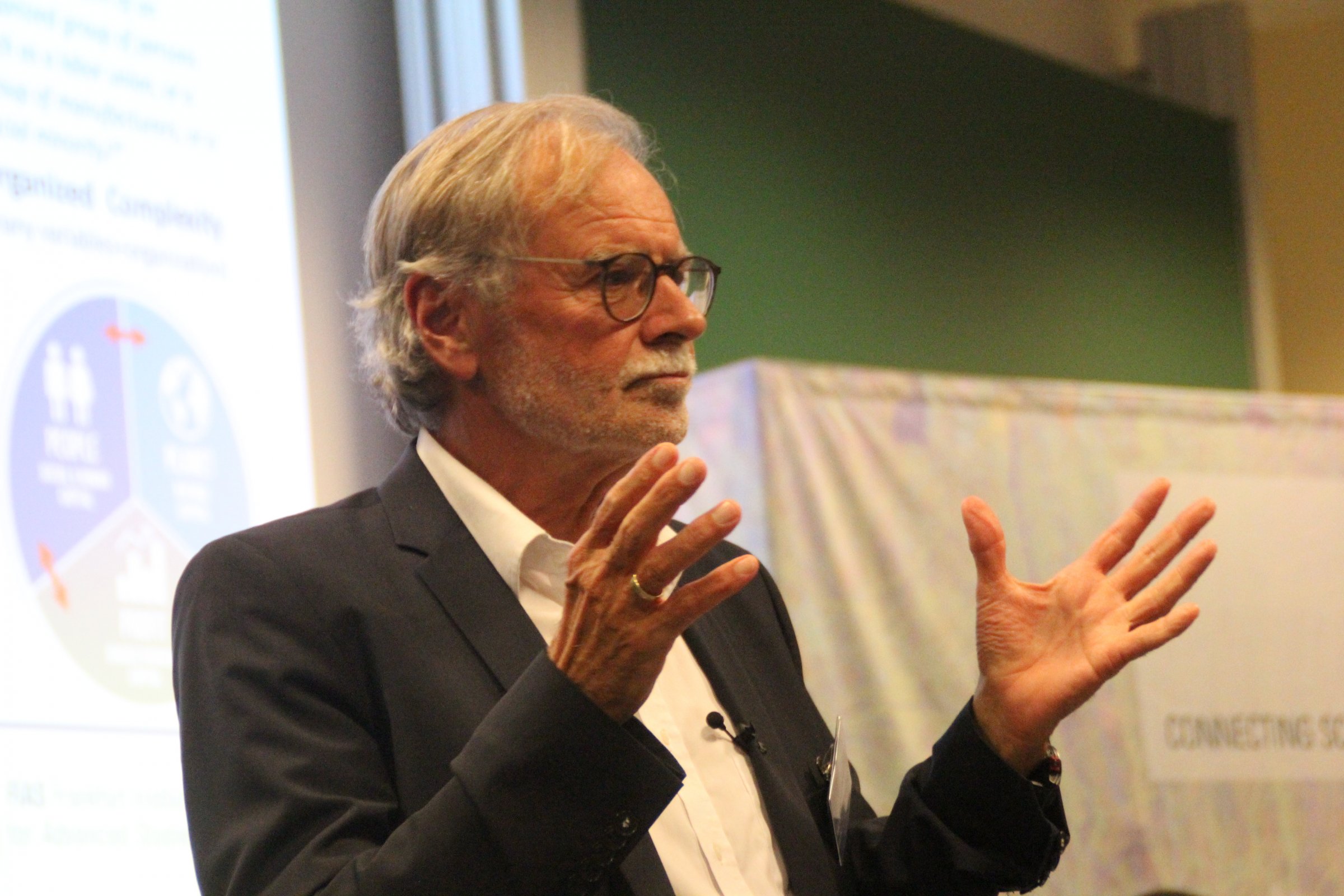FIAS Forum
Nächste Veranstaltung
26.06.2025 - 18.00 Uhr
Wie Computer der Zukunft rechnen
Prof. Dr. Thomas Lippert
Weitere Informationen folgen in Kürze.
Immer informiert!
Wir informieren Sie gerne per Email zu unseren öffentlichen Veranstaltungen, wie dem FIAS Forum. Tragen Sie sich einfach in unseren Veranstaltungsnewsletter ein.
AnmeldenDas FIAS Forum
Unsere öffentliche Vortragsreihe bereitet vierteljährlich aktuelle Themen aus den Naturwissenschaften und der gesellschaftlichen Debatte wissenschaftlich und verständlich auf. Dies ermöglicht spannende Diskussionen über die akuten Herausforderungen in der naturwissenschaftlichen Forschung und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft.
Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Empfang mit den Sprecher:innen und weiteren Wissenschaftler:innen des FIAS auszutauschen.
Auf dem Themenplan steht eine Palette unterschiedlicher Fragestellungen der aktuellen naturwissenschaftlichen Forschung. Diese reicht von aktueller medizinischer Forschung über Neurowissenschaften und moderne Informationstechnologie bis zum Urknall und dem Ursprung des Universums.
Wir sind sicher, dass diese Streiflichter aus der aktuellen Forschung Ihr Interesse finden werden, freuen uns über Ihr Kommen und hoffen auf anregende Diskussionen.
Vergangene Vorträge
28.11.2024
Dr. Nadine Flinner, Prof. Dr. Peter Wild
Die rasante Entwicklung der molekularen Diagnostik und der künstlichen Intelligenz (KI) revolutioniert die Gewebediagnostik und ermöglicht eine personalisierte Therapie in der Onkologie. Moderne KI-Methoden bieten nicht nur eine präzise Analyse komplexer Daten, sondern tragen auch dazu bei, die Inter-Observer-Variabilität zu reduzieren, indem sie die Konsistenz und Objektivität diagnostischer Entscheidungen erhöhen. Im Vortrag wird dargestellt, wie KI-gestützte Technologien in Kombination mit molekularen Analysen zur Verbesserung der Krebsbehandlung beitragen. Es werden konkrete Anwendungsbeispiele und Studienergebnisse präsentiert, die den Mehrwert dieser Innovationen für Diagnostik und Therapieplanung verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Integration dieser Methoden in die klinische Routine und den daraus resultierenden Vorteilen für Patienten und medizinisches Fachpersonal.
19.09.2024
Charlotte Warakaulle
Am 19.09.2024 sprach Charlotte Warakaulle, die erste Direktorin für internationale Beziehungen am CERN, über „Die Rolle des CERN in der Wissenschaftsdiplomatie“. Der Vortrag wurde auf Englisch gehalten, jedoch konnten Fragen und Diskussionen im Anschluss auf Deutsch geführt werden. Frau Warakaulle beleuchtete die Bedeutung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und die Rolle des CERN als Modell für Wissenschaftsdiplomatie.
Ihr Vortrag veranschaulichte die wichtige Rolle der wissenschaftlichen Zusammenarbeit über Grenzen und Kulturen hinweg. Sie führte das Publikum von der Gründung des CERN unter der Schirmherrschaft der UNESCO im Jahr 1954 bis zur heutigen globalen Gemeinschaft und diskutierte die wichtige Rolle der Wissenschaftsdiplomatie in einer zunehmend fragmentierten Welt.
Charlotte Warakaulle ist die erste Direktorin für internationale Beziehungen am CERN. Sie ist verantwortlich für die Zusammenarbeit des CERN mit Mitgliedstaaten und Nicht-Mitgliedstaaten sowie für den Aufbau von Partnerschaften mit internationalen Organisationen und Plattformen. Sie engagiert sich auch für die Ausweitung von Bildungs-, Kommunikations- und Outreach-Aktivitäten.
23.05.2024
Prof. Dr. Judith Simon
Wie können wir sicherstellen, dass die technologische Entwicklung im Einklang mit unseren ethischen Werten steht? Können wir KI vertrauen – und sollten wir das tun? 'Welche Verantwortung tragen wir in der Gestaltung und Nutzung von Informationstechnologie?' - Solche Fragen sind in den letzten Jahren immer wieder zentral in der Debatte um die voranschreitende Digitalisierung und künstliche Intelligenz.
Im ihrem Vortrag hat Professorin Judith Simon, Expertin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, genau diese Verschränkung ethischer, erkenntnistheoretischer und politischer Fragen im Kontext von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung beleuchtet. Als Mitglied des Deutschen Ethikrates und verschiedener anderer Gremien für wissenschaftliche Politikberatung brachte sie umfassende Perspektiven in die Diskussion ein.
07.03.2024
Dr. Sebastian Thallmair
Lichtschaltbare Moleküle sind aus unserem täglichen Leben kaum wegzudenken. Sie ermöglichen zum Beispiel eine der zentralen Formen unserer Wahrnehmung: das Sehen. Nach Aufnahme von Lichtenergie können sie ihre Struktur ändern. Der Einbau molekularer Lichtschalter in zukünftige Medikamente eröffnet faszinierende Möglichkeiten zur zeitlichen und räumlichen Steuerung von Medikamenten.
Der Einbau molekularer Lichtschalter in zukünftige Medikamente eröffnet faszinierende Möglichkeiten zur zeitlichen und räumlichen Steuerung von Medikamenten. So könnte ein Medikament zum Beispiel gezielt nur in den von einer Krankheit betroffenen Bereichen des Körpers aktiviert werden. Dies könnte in vielen Fällen Nebenwirkungen drastisch reduzieren.
Der Entwicklung lichtschaltbarer Medikamente bringt jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. So sollte der Einbau eines molekularen Lichtschalters die Wirkung eines Medikaments möglichst wenig beeinträchtigen. Gleichzeitig muss seine Schaltbarkeit erhalten bleiben. Außerdem sollte der molekulare Lichtschalter die Aufnahme durch den Verdauungstrakt überstehen.
07.12.2023
Prof. Dr. Eckhard Elsen
Die öffentlich geförderte Forschung in Deutschland stützt sich auf mehrere Säulen, deren wichtigste die Universitäten darstellen. Große und langfristige Forschungsprojekte können jedoch nur an größeren Instituten durchgeführt werden, für die in Deutschland hervorragende Beispiele angeführt werden können, die von Max Planck Instituten über Helmholtz-Institute bis hin zur Beteiligung an internationalen Organisationen reichen. Die übergreifende Nutzung der verschiedenen Institutionen führt zu hervorragenden und anerkannten Ergebnissen, die den Vergleich im internationalen Umfeld nicht scheuen müssen.
Gleichzeitig entwickelt sich aktuell weltweit eine Forschungsdynamik, der sich auch die Forschungsförderung stellen muss. Ist die existierende Struktur ausreichend für neue Themen und sind die Institutionen genügend agil? Welches sind die Standorte und was ist das Potenzial? Wie nachhaltig können sie arbeiten? Was ist die Bedeutung der Grundlagenforschung?
Der Vortrag versucht einen Überblick und zeigt die globalen Entwicklungen an konkreten Beispielen auf.
21.09.2023
Prof. Dr. Volker Mosbrugger
Es ist keine „Multikrise“ mit der wir in Deutschland, Europa und in der Welt konfrontiert werden, sondern eine „Systemkrise der Nachhaltigkeit“! Denn als Folge des Übergangs von einer „leeren Welt“ zu einer „vollen Welt“ in den letzten 70 Jahren ist keine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit heute zukunftsfähig: unser Gesellschaftsmodell steht in Frage (Stichworte: Wettbewerb der Systeme, Migration), unser Wirtschaftsmodell ebenso (Stichworte: Green Growth versus De-Growth) und nicht zuletzt bringt uns unser Umgang mit Natur(kapital) dramatische Umweltveränderungen (Stichworte: Klimawandel, Biodiversitätsverlust). Die notwendige große Transformation zur Nachhaltigkeit, wie sie die Vereinten Nationen global mit den UN Sustainability Development Goals, der „Green Deal“ in Europa und die Ampelkoalition in Deutschland anstreben, erfordern aber auch eine große Transformation der Bildung und Wissenschaft, die bisher jedoch in der Wissenschaftspolitik und in den Wissenschaftsinstitutionen noch weitgehend unbeachtet bleibt. Eckpunkte dieser notwendigen großen Transformation von Bildung und Wissenschaft sollen hier aufgezeigt und zur Diskussion gestellt werden.
08.05.2019
Dr. Hansjörg Schmitt, Pulse of Europe
Am 26.05.2019 wählte die Europäische Union ein neues Parlament. Als einer der Mitbegründer von Pulse of Europe erlebt Hansjörg Schmitt die Debatte um Europa hautnah.
Im Podiumsgespräch erläuterte Hansjörg Schmitt die Geschichte von Pulse of Europe, was Europa für die Wissenschaft bedeutet und wie es kommt, dass wir immer mehr pro und contra Europa argumentieren.
12.03.2019
Prof. Dr. Frank E. Brenker, Institut für Geowissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt
Die Frühphase unseres Sonnensystems liegt mehr als 4,5 Milliarden Jahre zurück. Geowissenschaftler der Goethe-Universität versuchen diese Anfangsphase, die letztendlich zur Bildung bewohnbarer Planeten führte, besser zu verstehen. Weltraummissionen tragen dazu bei, dass uns heute einzigartige Proben von sehr ursprünglichem Material für unsere Untersuchungen zur Verfügung stehen. Zudem bietet die Internationale Raumstation eine Plattform, diese durch experimentelle Arbeiten in Mikrogravitation nachzustellen.
Auf diese und weitere Facetten der Entstehung des Sonnensystems wurde im Vortrag von Prof. Dr. Frank E. Brenker am 12. März 2019 im Rahmen des FIAS Forums eingegangen.
30.01.2019
Dr. Christian von Wallbrunn, Hochschule Geisenheim University (HGU)
Gibt es nur „gute“ Hefen? Die Mehrzahl der Fermentationsgetränke wie Wein, wird unter Beteiligung von Hefen in der alkoholischen Gärung produziert. Zumeist wird von Weinhefen oder Bierhefen gesprochen, dabei handelt es sich immer um dieselben Hefen der Art Saccharomyces cerevisiae. Daneben gibt es aber noch eine Vielzahl weiterer Hefearten, die in Fermentationen positive oder negative Wirkungen auf die Qualität des entstehenden Produktes Wein haben können.
Auf diese und weitere Facetten der Weinherstellung wurde im Vortrag von Dr. Christian von Wallbrunn am 30. Januar 2019 im Rahmen des FIAS Forums eingegangen.
20.11.2018
Prof. Dr. Jürgen Schaffner-Bielich, Goethe-Universität
Die Raumzeit wird erschüttert, eine Gravitationswelle besonderen Maßes trifft den
Planeten Erde. Es stellt sich heraus, dass diese Gravitationswelle von Neutronensternen
stammt, die miteinander verschmolzen sind. Doch was sind diese Neutronensterne?
Wie entstehen sie? Und vor allem, aus welcher Materie bestehen sie im Innersten? Gibt es dort Quarks?
Über diese Fragen und noch mehr sprach Prof. Dr. Jürgen Schaffner-Bielich. Dabei
nahm er auch Bezug zur Quarkmaterie im Urknall und zur Erforschung von hochdichter
Materie im Labor und stellte Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie vor.
20.09.2018
Prof. Dr. Enrico Schleiff, FIAS, Goethe-Universität
Welchen Einfluss haben die Vereinigten Staaten von Amerika auf unser Bild von der Tomate? Welche Mechanismen hat die Tomate entwickelt, um auf wechselnde Strömungen der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika zu reagieren? Und was sagt uns die Verwendung der Tomate über die wahre Politik der Vereinigten Staaten von Amerika?
Im Vortrag wurde am Beispiel einer Pflanze und einer Frucht verdeutlicht, wie Politik, Gesellschaft und Staatlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika mit wissenschaftlichen Definitionen und Kenntnissen umgehen, Bilder prägen und sogar konträr zueinander agieren. Auch wurde der Frage nachgegangen, ob und wie Pflanzen – bis hinunter auf die molekulare Ebene – mit politischen Entscheidungen umgehen; eine Reise zwischen wahren Anekdoten und wissenschaftlichen Fakten, und das eine oder andere darüber, wie Pflanzen funktionieren.
12.06.2018
Matthias Alfeld, Sorbonne Université, Paris
Chemiker Matthias Alfeld untersucht an der Sorbonne Université in Paris Kunstwerke großer Meister und archäologische Fundstätten mit modernen wissenschaftlichen Methoden.
Bei der bildgebenden Spektroskopie wird für jeden Bildpunkt ein vollständiges Spektrum aufgenommen. Aus diesen Daten können dann chemische Verteilungsbilder berechnet werden, die je nach der verwendeten Wellenlänge Informationen über die Oberfläche eines Objektes oder die Schichten darunter liefert. Bildgebende Spektroskopie mittels Röntgenfluoreszenz Analyse (RFA) hat es in den vergangenen Jahren erlaubt, neue Einblicke in Gemälde zu gewinnen. Die Methode entwickelte sich innerhalb weniger Jahre von einer experimentellen Technik an Teilchenbeschleunigern zu einer kommerziell verfügbaren Methode. Ihre Möglichkeiten werden an Hand von Werken Vincent van Goghs und Rembrandts gezeigt. Die Friese des Siphnierschatzhauses (um 525 v. Chr.) am Orakel von Delphi waren ursprünglich farbig gestaltet. Von dieser Pracht ist heute nur noch wenig erhalten. An diesem Beispiel wird gezeigt werden, wie bildgebende Spektroskopie im sichtbaren Bereich und dem nahen Infrarot zusammen mit RFA die klassische Archäologie ergänzt und es erlaubt, neue, bisher verborgene Spuren zu finden. Der Malstil des alten Ägypten ist sehr charakteristisch und auch für Laien leicht zu erkennen. Entsprechend dem streng formalen Aufbau wird häufig auch von einer streng formalen Ausführung ausgegangen. Unsere Messungen in mehreren Gräbern aus der Zeit Ramses II (1303-1213 v. Chr) in der Nekropole zu Theben nahe Luxor zeigen jedoch, dass auch innerhalb eines Grabes Maltechnik und Pigmentnutzung deutliche Unterschiede aufweisen können.
19.04.2018
Prof. Dr. Marcel A. Verhoff, Universitätsklinikum Frankfurt
Heute gibt es keinen Krimi mehr ohne Rechtsmedizin. Doch was steckt dahinter? Wieviel Wahrheit zeigt das Fernsehen?
Antworten darauf gibt Prof. Dr. Marcel A. Verhoff, Direktor des Frankfurter Instituts für Rechtsmedizin. Außerdem entführt er in ungewöhnliche wissenschaftliche Fragestellungen, die ein anderes Licht auf die Arbeit der Rechtsmedizin werfen werden.
17.01.2018
Prof. Dr. Heidi Keller; Universität Osnabrück und Hebrew University, Jerusalem
Wir alle haben Vorstellungen darüber, wie Kinder sind, was Kindsein ausmacht, wie Kinder sich verhalten sollten, wie man die Entwicklung von Kindern fördern kann, was schädlich ist. Diese Vorstellungen sind verknüpft mit Annahmen darüber, was eine Familie ist und welche Rolle sie für die Entwicklung von Kindern spielt. Diese Vorstellungen, unsere Bilder vom Kind und von Familie sind in unserem Menschenbild verankert – und das ist kulturell geprägt und definiert.
Auch wissenschaftliche Theorien sind kulturell geprägt, denn auch Wissenschaftler handeln und forschen im Rahmen ihrer Menschenbilder. Die Bindungstheorie, die verbreiteteste Theorie zur sozial emotionalen Entwicklung, macht da keine Ausnahme. Sie basiert auf dem Bild vom Kind und Familie in der westlichen Welt der Nachkriegsgeneration, wie die Wissenschaftshistorikerin Marga Vicedo schlüssig aufgewiesen hat.
In diesem Vortrag werden die grundlegenden Annahmen der Bindungstheorie kritisch reflektiert und im Hinblick auf Kulturspezifität analysiert. Dazu werden Forschungsbefunde aus der Kulturanthropologie und Kulturpsychologie/kulturvergleichenden Psychologie herangezogen.
Die Bindungstheorie leitet ihren Universalitätsanspruch aus der evolutionären Theorie ab. Auch hier ist eine kritische Reflektion notwendig, da die Definition einer fixen, kontextunabhängigen Verhaltensqualität nicht mit evolutionären Annahmen vereinbar ist.
Diese Überlegungen haben weitreichende Implikationen für Wissenschaft und Praxis. Aus wissenschaftlicher Perspektive müssen Theorien und Befunde kontextualisiert werden, d.h. es gibt nicht den einen gesunden Entwicklungspfad und mögliche Abweichungen, wie derzeit in unseren Lehrbüchern dargestellt, sondern unterschiedliche Entwicklungspfade mit jeweils eigener Logik. Aus einer Anwendungsperspektive bedeutet dies, dass die gängige Praxis der Anwendung der westlichen Psychologie und Pädagogik auf alle Menschen nicht nur möglicherweise wirkungslos, sondern auch oftmals schädlich sein kann. Die implizierten ethischen Fragen werden diskutiert.
21.11.2017
Prof. Dr. Jan Peters; Institut für Informatik, TU Darmstadt
Autonome Roboter, welche Menschen in einer großen Anzahl von Situationenunterstützen können, sind ein erklärtes Ziel der Robotik, der künstlichen Intelligenz und der Kognitionswissenschaft. Um dieses Ziel aus dem Bereich der Science Fiction in die Realität zu bringen, muss die Instruktion von Robotern so einfach werden, dass auch ein ungelernter Laie "seinen" Roboter selber unterrichten kann. Leider haben die Methoden des klassischen maschinellen Lernens uns diesem Ziel bisher nicht deutlich näher gebracht. Eine Ursache dafür ist, dass sie die physikalische Realität nicht einbeziehen und daher nicht die komplexen Probleme der Robotermotorik adressieren können.
In diesem Vortrag zeigen wir auf, wie zukünftige Roboter ihre Aufgaben autonomer und intelligenter erlernen können. Demonstriert wird, wie ein Roboter zunächst einzelne primitive Elementarbewegungen durch eine Kombination aus Imitation und Selbst-Verbesserung erwerben kann. Danach wird an Beispielen deutlich gemacht, wie der Roboter seine Elementarbewegungen zunächst an neue Situationen anpassen kann und dann mit diesen anfangen kann, Verhalten zu komponieren. Dieser Weg von einfachen zu immer komplexeren Verhaltensweisen wird mit Experimenten untermalt, in denen Roboter gehen, greifen, und Tischtennis spielen.
03.07.2017
Prof. Dr. Franziska Matthäus, FIAS
Zellen, die kleinsten Bausteine von Organismen, nehmen im Körper verschiedene Funktionen wahr. Manche dieser Funktionen - wie die Immunabwehr, Entwicklungs- oder Heilungsprozesse - erfordern auch, dass Zellen sich im Organismus bewegen. Teilweise bewegen sich dabei koordiniert ganze Gewebebereiche und zeigen Charakteristiken, die man auch in Vogel- oder Fischschwärmen beobachten kann. Zellmigration spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung von Metastasen in Krebserkrankungen. Es ist die klassische Vorstellung, dass bei einer vorhandenen Krebserkrankung Metastasen dadurch entstehen, dass sich einzelne Zellen vom Primärtumor ablösen und über Blut oder Lymphflüssigkeit in andere Gewebe gelangen. Dort vermehren sie sich und bilden sekundäre Tumore. Seit einiger Zeit ist allerdings bekannt, dass auch bei vielen Krebsarten nicht einzelne Tumorzellen, sondern Zellgruppen oder Gewebebereiche gemeinsam und koordiniert Bewegungsprozesse ausführen. Es wird auch vermutet, dass Metastasen eher aus gemeinsam “marschierenden” Zellgruppen hervorgehen als aus einzelnen abgelösten Tumorzellen. Aber warum ist das so? Wie orientieren sich Zellen im Raum? Und wie koordinieren sie sich in Gruppen? Aus Sicht der Biophysik ist jedenfalls klar: Ob Zellen, Fische oder Vogelschwärme - die Grundprinzipien für kollektive Bewegung sind immer gleich.
17.05.2017
Prof. Dr. jur. Rudolf Steinberg; Präsident der Goethe-Universität a.D.
Was soll man 60-Minuten lang über Scharia und Grundgesetz sagen? Hat doch die Kanzlerin Angela Merkel bereits 2010 nach der berühmten Rede des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff über den Islam in Deutschland klipp und klar erklärt: „Es gilt bei uns das Grundgesetz, und nicht die Scharia.“ Und ganz ähnlich äußerte sie sich auf dem letzten CDU- Parteitag in Essen am 6. Dezember 2016: „Unser Gesetz hat Vorrang vor Ehrenkodex, Stammes und Familienregeln und der Scharia, das muss ganz deutlich ausgesprochen werden.“ Roma locuta causa finita? Dagegen wendet sich der Publizist Henryk M. Broder: Wer der Meinung sei, der Islam gehöre zu Deutschland, sollte nicht zögern, einen Schritt weitergehen und erklären: „Auch die Scharia gehört zu Deutschland. Denn ohne die Scharia gibt es keinen authentischen Islam.“ Und er fügt – wohl eher sarkastisch - hinzu, dass die Einführung der Scharia „das friedliche Zusammenleben erleichtern“ würde. Was ist nun richtig?
Ganz offensichtlich hat „die“ Scharia in unserem Lande keinen guten Ruf. Sie sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Gemeint sind vor allem die drakonischen Strafen in Saudi-Arabien, dem Iran oder dem sog. Islamischen Staat.
Das ist allerdings – wie ich in einem ersten Schritt zeigen möchte viel zu eng. „Die“ Scharia gibt es anders als häufig unterstellt überhaupt nicht (II.). Ich will anschließend das Verhältnis von Verhalten, das sich auf die Scharia stützt, zum Grundgesetz untersuchen, das ein wenig komplexer ist, als die einleitenden Äußerungen nahelegen (III.). Das Scharia konnotierte Verhalten ausschließlich unter der Perspektive der Verfassungsmäßigkeit oder Verfassungswidrigkeit zu betrachten, bleibt jedoch an der Oberfläche der Probleme. Wichtiger erscheint es mir zu fragen, wie lässt es sich erreichen, dass sich eine große Gruppe von Menschen mit einem religiös und kulturell anderen Hintergrund nicht dauerhaft als Fremde empfindet, sondern als Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten ihren Platz in der freiheitlich Ordnung unseres Gemeinwesens findet (IV.). Abschließend möchte ich deutlich machen, dass sich ein Scharia-Verständnis, wie es von führenden muslimischen Theologen vertreten wird, durchaus sich in unsere Ordnung einfügt. Dass dies mit Zuversicht zu hoffen ist, zeigt auch ein kurzer Blick in die Geschichte des Verhältnisses von Staat und Religion.(V.).
05.04.2017
Prof. Dr. Theodor Dingermann; Goethe-Universität, Frankfurt
Wie wirkt sich die Evolution des Menschen auf unsere Gesundheit bzw. unsere Krankheiten aus? Hat Darwin – im übergeordneten Sinne als Dr. Darwin im weißen Chefarzt-Kittel – auch hier seine Hand im Spiel? Die Antwort: Und ob!!
Man spricht heute von „Darwinian Medicine“, die Fragen zu Krankheit und Gesundheit ganz anders stellt als die Schulmedizin. Fragt die Schulmedizin, wie entstehen Krankheiten, so fragt die Darwinische Medizin, warum entstehen Krankheiten bzw. das, was wir als Krankheit definieren. Warum hat uns die Evolution so anfällig für Krankheiten gemacht? Warum plagen uns Rückenschmerzen und Bluthochdruck? Warum erkranken wir an Herzinfarkt, Krebs oder Alzheimer?
Was heute als Risiko für Krankheiten erkannt ist, war in den Frühphasen der menschlichen Evolution u.U. ein Überlebensvorteil. Und Probleme, mit denen wir heute bei den typischen Alters- krankheiten konfrontiert sind, wie Alzheimer, Parkinson oder Krebs, waren im Kontext evolutionärer Konzepte irrelevant, da die Menschen in ihrer frühen Entwicklungsphase nicht so alt wurden. Evolution ist sehr, sehr langsam. Mit der rasanten technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte konnte unsere „Programmierung“ in Form des menschlichen Genoms nicht mithalten.
15.02.2017
Prof. Dr. Dr. h.c. mult Horst Stöcker; FIAS, Goethe-Universität Frankfurt
Die Entdeckung der Gravitationswellen, die Einstein vor hundert Jahren vorhergesagt hat, eröffnet ganz neuartige Einblicke in das Universum: Neutronensterne und schwarze Löcher umtanzen einander und verschmelzen in gewaltigen kosmischen Explosionen.
Die Frankfurter Arbeiten zu diesem Thema werden vorgestellt und die Verbindung zur FAIR Beschleunigeranlage bei der GSI, Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, wird erläutert.